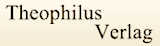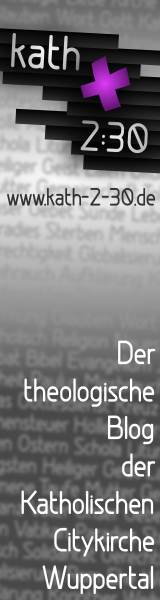Sonderausgabe, September 2013
Ehe wandelt sich – und bleibt doch Ehe
Eine Stellungnahme zur Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

162 Seiten zum Thema Familie.
Was in den Medien davon übrig bleibt sind meist kontroverse Punkte wie die „Homoehe“.
Text Dr. Werner Kleine
Bild Christoph Schönbach
Kirchliche Verlautbarungen – ob evangelisch oder römisch-katholisch – teilen gegenwärtig ein gemeinsames Schicksal: Egal wie umfangreich und gediegen ihre Argumentation oder die Entwicklung neuer gesellschaftlich relevanter Perspektiven auch ist – das Auge der Öffentlichkeit sucht immer nur das eine. Was für päpstliche Enzykliken das Wort „Kondom“ ist, ist für Dokumente der evangelischen Kirche die „Homoehe“. Immer wieder zeigt sich der gleiche Reflex: Die weltlichen Medien preisen die gesellschaftliche Offenheit der reformatorischen Kirchen, während römisch-katholische Rezensenten darauf verweisen, dass der ökumenische Rubikon bereits überschritten sei.
Es stünde den Autoren in jedem Fall gut zu Gesicht, sich vor einer Stellungnahme die Zeit zu nehmen und das fragliche Dokument auch zu lesen. Es gehört ja zum investigativen Anspruch selbst kirchlicher Medien, die Aussagen in der ihnen zukommenden Weise zu gewichten.
„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“, unter diesem Titel hat die EKD eine 160seitige Schrift veröffentlicht, die sich als Orientierungshilfe versteht. Nikolaus Schneider, der Vorsitzende des Rates der EKD stellt in seinem Vorwort fest, dass es in der Orientierungshilfe darum geht, „Familien, in denen Menschen füreinander Sorge und Verantwortung übernehmen, (...) Unterstützung und gute Rahmenbedingungen“ anzubieten. Damit ist eine evangelische Definition der Familie gegeben: Familie ist da, wo Menschen füreinander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen. Das ist der Ansatz, mit dem man sich auseinandersetzen muss, denn dieser Ansatz hat weitreichende Folgen für das Verständnis von Ehe und Familie, das aus der römisch-katholischen Sicht grundsätzlich anders definiert wird. Aber dazu später mehr.
Ehe und Familie war und wird anders
Zuerst ist festzustellen, dass die Orientierungshilfe der EKD ein bemerkenswertes Dokument ist, das keine Facette moderner Familienrealität außer Acht lässt. Ehe und Familie werden hier nicht begrenzt auf das Vater-Mutter-Kind-Schema, wobei es den Anschein hat, dass „Kind“ dann meist „Kleinkind“ heißt. Familie endet ja nicht mit der Beendigung der Kindergartenphase. Dass Familien in der gesellschaftlichen Realität der Gegenwart komplexen Anforderungen ausgesetzt sind, nimmt die Orientierungshilfe nicht nur wahr; sie untermauert dies im Stil einer soziologischen und politischen Untersuchung. Herausragende Themen sind dabei „Alltag und Fest“ und die damit verbundene Frage nach der Ermöglichung gemeinsamer Zeiten und der Bedeutung des Sonntags für die Familie sowie die Bedeutung und Neureflexion des Verhältnisses von „Erwerbsarbeit und Sorgetätigkeiten in der Familie“, die nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit sowie die familiäre Arbeits- und Rollenteilung hinterfragt, sondern auch die Hausarbeit und die damit verbundenen Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeiten als „Sorge für die Welt“ neu qualifiziert und wertschätzt. Weitere Themen sind „Erziehung und Bildung“, „Generationenbeziehungen und Fürsorglichkeit“, die Bedeutung der „häuslichen Pflege“, das Erkennen und Reagieren auf „Gewalt in Familien“, die Entwicklung von „Migration und Familienkulturen“, sowie die Frage nach „Reichtum und Armut von Familien“. So kommt die Orientierungshilfe zu dem Schluss, dass „Familienpolitik als neue Form sozialer Politik“ zu betreiben sei.
Das Ernstnehmen der soziologischen Dimension der gegenwärtigen Familienrealitäten ist die große Stärke der Orientierungshilfe. Man merkt ihr an, dass mit Dr. Christine Bergmann eine ehemalige Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend federführend war. Hierher rührt wahrscheinlich auch der starke politische Duktus des Dokumentes, der seine Gegenwartsrelevanz bestimmt.
Was ist eigentlich Ehe?
Die politische Stärke ist aber zugleich auch eine theologische Schwäche. Man hat bisweilen den Eindruck, die Orientierungshilfe sei eine Druckvorlage zur Umsetzung einer Novelle der familienpolitischen Gesetzgebung. Für ein kirchliches Dokument kommt die theologische Argumentation und ein daraus resultierender pastoraler Impuls deutlich zu kurz. Schon zu Beginn wird mit dem „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, ein Satz zitiert, der innerhalb des Textes noch häufiger als theologisches Axiom herhalten muss. Merkwürdig ist aber gerade für ein Dokument der evangelischen Kirche, für die das sola scriptura-Prinzip prägend ist – also die Auffassung, dass allein die Heilige Schrift zu gelten habe – dass hier keine Bibelstelle angegeben wird. Es heißt lediglich, dass dieser Satz in einer der ersten Geschichten der Bibel stehe. Das ist nicht nur eine deutliche Untertreibung, sondern sogar irreführend. Der Satz entstammt dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Er findet sich in Genesis/1. Mose 2,18 und geht dort dem Entschluss Gottes voraus, mit der revidierten Lutherübersetzung mit den Worten „ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei“. In der wörtlichen Übersetzung müsste es sogar „Männin“ heißen, also ein echter Gegenpart zum Mann.
Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Zusammenhang überspielt wird, denn er hat Konsequenzen für das christlich-jüdische Eheverständnis, das auf einer Beziehung von Frau und Mann gründet. Damit ist nichts über oder gar gegen homosexuelle Beziehungen gesagt. Es besteht kein Zweifel, dass auch in homosexuellen Beziehungen auf gegenseitiger Verantwortung und Sorge beruhende Partnerschaften gelebt werden. Es besteht auch kein Zweifel, dass der Staat die Verantwortung hat, für diese gesellschaftliche Realität entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Christen und Juden kommen aber an dem Wort der Schrift nicht vorbei. Denn gerade hierin begründet sich die Aussage Luthers, die Ehe sei ein „weltlich“ Ding. Sie ist „weltlich“, weil sie sich aus dem Schöpfungswillen Gottes ergibt. Sie gehört eben in diese Welt. Für das Eheverständnis ist daher gegen die Orientierungshilfe festzuhalten, dass die Beziehung von Mann und Frau mit dem Ziel der Zeugung von Nachkommenschaft („Seid fruchtbar und vermehrt euch.“ Genesis/1. Mose 1,28) als göttlicher Auftrag eben doch eine absolut gesetzte Ordnung ist, auch wenn sie sich keiner jesuanischen Satzung verdankt. Man wird aus diesem Willen Gottes nicht den Umkehrschluss ziehen dürfen, nur Beziehungen zwischen Mann und Frau seien gottgewollt. Die Beziehung von Mann und Frau ist es freilich definitiv, weil biblisch begründet. Das ist für die römisch-katholische Definition von Ehe ebenso konstitutiv wie die potentielle Möglichkeit der Zeugung von Nachkommen. Letzteres ist der Grund, warum die römisch-katholische Kirche keine Ehe zwischen homosexuellen Partnern kennt, da hier die Zeugung von Nachkommen biologisch unmöglich ist. Ebensowenig kommt nach römisch-katholischer Auffassung übrigens eine Ehe zustande, wenn mindestens einer der Partner die Zeugung von Nachkommen ausschließt oder wissentlich zum Zeitpunkt der Eheschließung zur Zeugung von Nachkommen nicht in der Lage ist. Ehe, das ist in der biblisch begründeten Sicht der römisch-katholischen Kirche die lebenslange, exklusive Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die potentiell auf Zeugung von Nachkommen angelegt ist. Das bedeutet nicht, dass andere Lebensformen defizitär wären. Sie sind eben anders. Hierfür neue Formen zu finden, ist sicher eine Notwendigkeit kirchlichen Handelns.
Behauptungen brauchen Belege
Zweifellos ist dem an der Ruhr-Universität Bochum lehrenden evangelischen Theologen Jürgen Ebach Recht zu geben, der in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau vom 26. August 2013 feststellt, dass die Bibel kein eindeutiges Bild von Familie enthält, das zeitlos gültig wäre. Auch ist ihm zuzustimmen, wenn er ausführt, dass nicht jede Norm der Bibel überzeitliche Gültigkeit beanspruchen kann. Man wird also aus der kritischen Haltung der biblischen Schriften zur Homosexualität ebenso wenig eine allgemein gültige Norm ableiten dürfen, wie das etwa für das jesuanische Verbot gilt, niemanden „Vater“ zu nennen, außer dem Vater im Himmel. Und doch kann man nicht, wie die Orientierungshilfe es tut, allgemein behaupten, es gäbe „biblische Texte, die von zärtlichen Beziehungen zwischen Männern sprechen“ (Orientierungshilfe, S. 66).
Leider bleiben die Autoren der Orientierungshilfe einen Beleg für diese Behauptung schuldig. Vermutlich spielen sie auf die Beziehung des Königs David zu Jonathan an, von der es in der revidierten Lutherübersetzung heißt: „Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. (...) Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt.“ (1. Samuel 18,1.4) Hieraus eine homosexuelle Beziehung zu folgern, bedeutet, mehr in den Text hineinzulesen, als er sagt. Der Text beschreibt einfach die intensive freundschaftliche Verbundenheit zwischen David und Jonathan, die füreinander das letzte Hemd zu geben bereit sind.
Die Herausforderung bleibt
Es ist schade, dass die evangelische Kirche mit einem solch freizügigen Umgang mit der Heiligen Schrift ihre eigene theologische Basis so wenig ernst nimmt. In der Folge kommt man dann zu der eingangs zitierten offenen Familiendefinition, die auf gegenseitiger Verantwortung und Sorge beruht. Aber gilt das nicht auch für jeden Sportverein? Ist die Beziehung zwischen einem Trainer und seinen Spielern nicht auch von gegenseitiger Verantwortung und Sorge getragen? Und was ist, wenn drei und mehr Partner sich darauf einigen, füreinander Verantwortung und Sorge zu tragen?
In der säkularen Welt ist vieles denkbar und faktisch möglich. Es steht niemandem zu, die unterschiedlichen Lebenskonzepte zu be- oder verurteilen. Oberstes Ziel ist das Glück des Menschen ohne die Unterdrückung anderer. Es ist auch richtig, dass der Staat Sorge für die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen trifft. Als Kirche kommt man aber nicht am Wort Gottes vorbei, ohne das eigene Fundament in Frage zu stellen. Gerade darin liegt auch die Stärke der Kirche, die nicht jeden gesellschaftlichen Trend bestätigen muss. Die Orientierungshilfe des Rates der EKD ist deshalb ein durchaus bedeutendes Papier, das viele wichtige Impulse bereit hält, in der theologischen Dimension bisweilen aber auffällig zurückhaltend ist. Das ist schade für den ökumenischen Diskurs, denn auch die römisch-katholische Sicht auf Ehe und Familie bedarf angesichts der gesellschaftlichen Realitäten immer wieder einer Neubetrachtung, um manches, was vor langer Zeit sinnvoll war, modern lebbar zu machen.
Ehe war anders als sie heute ist, und sie wird sich auch in Zukunft ändern. Und ja, es gibt Lebenskonzepte, die zum Glück der Menschen beitragen, auch wenn sie nicht durch das biblisch begründete Ehebild der christlich-jüdischen Tradition gedeckt sind. Hier hat die römisch-katholische Kirche sicher Nachholbedarf an Formen der – auch rituellen – Begleitung. Um Kirche und Welt miteinander zu verbinden, müssen immer neue Brücken gebaut werden. Brücken brauchen Pfeiler. Ein Hauptpfeiler, an dem keine Kirche vorbeikommt, ist freilich das Wort der Heiligen Schrift.


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz