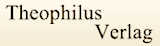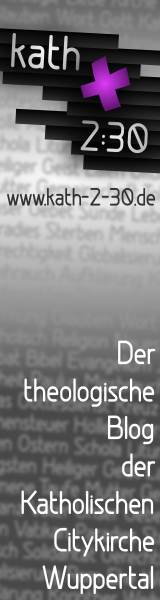Ausgabe 12, August 2014
„Ich gehöre eigentlich nirgendwo hin“
Der Wuppertaler Goran Milovanovic hat einen hohen Preis für ein Leben zwischen den Welten bezahlt.

Selbst während der Fußballweltmeisterschaft fühlte sich Goran Milovanovic keinem Land zugehörig. Freude über den deutschen WM-Sieg? Eher nicht.
Text und Bild Eduard Urssu
Mit 18 Jahren sollte er Deutschland verlassen, obwohl er hier geboren war: Goran Milovanovic war in einen Konflikt der hiesigen Behörden mit den Nachfolgestaaten Jugoslawiens geraten. Es folgte eine emotionale Odyssee, die den heute 42-Jährigen psychisch krank machte.
Heute kann Goran Milovanovic fast mit etwas Gelassenheit auf seine letzten 25 Jahre zurückblicken. Fast. Immer wieder erfasst ihn eine innere Unruhe, obwohl sein Leben mittlerweile geordnet ist. Etwas fahrig und unstrukturiert wirken seine Worte, wenn er von seinem schwersten Lebensabschnitt erzählt.
Denn Goran Milovanovic sollte es eigentlich gar nicht geben. Und als er dann doch da war, gehörte er nirgendwo hin. Sein Vater kam in den Siebzigerjahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland. Abkommen zwischen beiden Staaten sorgten für die vereinfachte „Einfuhr“ von günstigen Arbeitskräften. Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten – so war der Plan. Privatleben? Fehlanzeige! Davon zeugten auch die trostlosen Arbeiterwohnheime, zum Beispiel am Kleinen Werth. Eine Integration der ausländischen Arbeiter in die deutsche Gesellschaft war schlicht: unerwünscht.
„Dann lernte mein Vater meine Mutter kennen“, sagt Goran Milovanovic, „kurze Zeit darauf wurde ich geboren.“ Doch die Gründung von Familien war in den Staatsverträgen nicht vorgesehen. Eine entsprechende Integrationsstrategie für sie gab es nicht. „Mich dürfte es gar nicht geben“, eine Erkenntnis, die Goran Milovanovic in vielen Situationen gespiegelt bekam: „Während meiner Grundschulzeit in Wichlinghausen oder auf der Realschule Ost – immer saß ich zwischen den Stühlen. Seine Eltern förderten ihn, wo sie nur konnten, erinnert sich Goran Milovanovic: „Bei uns zuhause hieß es immer ‚Wissen ist Macht, nichts wissen ist blöd’. Danach versuchte ich zu leben. Und gelesen habe ich immer schon gerne.“ Doch sein Weg zum sogenannten Berufsverweigerer war da bereits geebnet.
Wenig Unterstützung
Dabei gab es immer wieder Menschen, die ihn unterstützen wollten. „Es gab da zum Beispiel einen Lehrer an der Realschule, oder eine Betreuerin im Sozialamt“, erinnert sich Goran Milovanovic. Doch der soziale und gesellschaftliche Druck war zu groß. Zumal es ein Kampf an drei Fronten war: „Da war immer mein Status der Duldung und der damit verbundene Gang zur Ausländerbehörde, die frustrierende Situation auf dem Sozialamt und meine katastrophale finanzielle Situation. Und dann noch der Kampf mit den jugoslawischen Behörden.“ Bereits mit 16 Jahren sah sich Goran Milovanovic einer Flut von Problemen gegenüber. Das Gravierendste aber war seine Staatenlosigkeit. Nachdem die Republik Jugoslawien in den Neunzigerjahren zerfiel, wusste er nicht mehr, wohin. „Ich fühlte mich als Deutscher“, erinnert er sich, „aber mein Reisepass sagte etwas anderes.“
Doch dieser Reisepass war nun nicht mehr gültig, das bestätigte ihm ein Schreiben der diplomatischen Vertretung Serbiens: „Ich habe einen zweisprachigen Brief erhalten, ich sollte mich melden. Dort wurde mir durch die Blume gesagt, dass ich zuerst meinen Militärdienst antreten müsse, um überhaupt als serbischer Staatsbürger anerkannt zu werden. Das kam für mich nicht infrage. Schließlich zeichnete sich da schon der Krieg ab. Um den bürokratischen Ablauf zu ‚beschleunigen’, hätte ich auch noch Geld zahlen können. Mehrere Tausend Euro. Aber ohne eine Garantie, dass ich nicht doch eingezogen werde.“ Geld zahlen, das man nicht hat, trotzdem in den Krieg ziehen müssen und mit dem Schlimmsten rechnen – das konnte und wollte Goran Milovanovic sich nicht leisten. „Ich hatte Angst, dass ich sterben könnte“, bringt er es auf den Punkt.
Psyche leidet
Die Ungewissheit, die drohende Abschiebung, all das hat den empfindsamen Jugendlichen damals stark mitgenommen. Irgendwann machte seine Psyche nicht mehr mit. Mit 20 Jahren hatte Goran Milovanovic seinen ersten Zusammenbruch und wurde fortan gesetzlich betreuut. „Ich habe dann von diesem ganzen bürokratischen Prozess kaum etwas mitbekommen. Amnesty International, die engagierten Anwälte, alles lief irgendwie an mir vorbei. Ich habe viele Jahre in der Psychiatrie zugebracht. Insgesamt drei stationäre Aufenthalte und aktuell meine ambulante Behandlung. Aber auch unter denen die ‚anders’ sind, fühlte ich mich immer noch ein wenig mehr anders“, sagt er. Bis 2005 zog sich seine quälende Unsicherheit hin, dann endlich ein Silberstreif am Horizont. „Mit der Regierungsübernahme der SPD änderte sich die Gesetzeslage. Die Möglichkeit zur Beantragung der Doppelten Staatsbürgerschaft war mein Glück. Vor allem, dass sich die Behörden auf jugoslawischer Seite quer stellten. Meine deutsche Einbürgerungsurkunde habe ich dann im kleinen Rahmen, in irgendeinem Hinterzimmer erhalten“, erinnert sich Goran Milovanovic.
Eigeninitiative
Mit der Einbürgerungsurkunde in der Hand war dennoch erst der halbe Kampf gewonnen. Ohne Ausbildung, ohne berufliche Perspektive – nun war Eigeninitiative und Kreativität gefragt. „Ich habe nicht mehr auf Wunder gewartet. Wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen muss“, erzählt Goran Milovanovic. Auf Umwegen und mit der Unterstützung eines kirchlichen Trägers konnte er eine theaterpädagogische Ausbildung machen. Mittlerweile arbeitet Goran Milovanovic beim Projekt „Oase“ zur Wiederbelebung des Stadtteils Wichlinghausen. „Meine schlechten Erfahrungen haben mich kreativ gemacht. Das war sozusagen die Grundlage für einen Beruf im künstlerischen Bereich. Und mittlerweile bin ich mit mir im Reinen, mit den Behörden noch nicht“, sagt Goran Milovanovic und ringt sich ein leichtes Lächeln ab.


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz