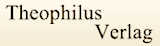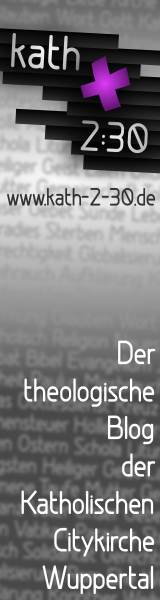Ausgabe 10, Dezember 2013
„Heimat, das ist etwas anderes“
Die Geschichte eines Flüchtlings aus dem Iran
Text Eduard Urssu
Asylpolitik ist von Menschen gemacht. Ist sie aber auch für die Menschen gemacht, die wirklich Hilfe und Unterstützung benötigen? Amir S. (Name von der Redaktion geändert) hat die ganze Härte der deutschen Asylpraxis erfahren. Vor neun Jahren ist er aus dem Iran geflohen. Die Umstände seiner abenteuerlichen Flucht, das Bangen und die Angst um seine Familie, lassen ihn bis heute nicht los. „Ich wollte überhaupt nicht weg, ich hatte ein schönes Leben in meiner Heimat“, erinnert sich Amir. „Ein Großteil meiner Familie, meine ganzen Freunde waren dort. Ich habe studiert und wollte meine eigene Firma aufbauen.“ Alles schien auf ein geregeltes Leben zuzusteuern. Bis zum Tag der Demonstration. „Mit Freunden habe ich an einer genehmigten Kundgebung teilgenommen. Wir haben für bessere Studienbedingungen demonstriert, für mehr demokratischen Wandel in unserem Land“, sagt Amir. An die Stunden danach kann er sich kaum erinnern. Ein Unbekannter stach ihm mit einem Teppichmesser zwei Mal in die Brust. Ein Stich zerfetzte den linken Lungenflügel. Zu Hause zeigte er die Fotos. „Später habe ich erfahren, dass sich neben den offiziellen Ordnungskräften auch Einheiten der Geheimpolizei unter die Demonstranten gemischt hatten.“ Ein tiefer Schnitt im Nacken, Hämatome über Gesicht und Oberkörper verteilt. Amir ist sich sicher, dass er das nicht überleben sollte.
Keine Wahl
Doch er überlebte und fasste einen gefährlichen Entschluss: Er wollte fliehen. Nein, er musste fliehen, korrigiert sich Amir später. Mit seiner Frau vertraute er sich Bekannten an. „Allein das ist gefährlich. Überall lauern Spitzel, die mit Verrat ihren Lebensunterhalt verdienen. Und die, die verhaftet werden, verschwinden für immer“, sagt Amir. Von Angehörigen und Freunden musste er sich Geld leihen, viel Geld. Umgerechnet 8.000 Euro. „Damit konnte damals im Iran eine ganze Familie ein Jahr gut leben. Ich konnte kein eigenes Geld nehmen“, sagt er. „Mein Konto wurde überwacht. Bei einer solch hohen Abbuchung wären wir sofort aufgeflogen.“ Für das Geld bekam er eine Telefonnummer. Am anderen Ende der Leitung war eine Stimme, die ihm klare Anweisungen gab: „Wir mussten nachts an einer bestimmten Bushaltestelle am Stadtrand von Urmia stehen. Dann kam ein Auto, und wir stiegen ein,“ berichtet Amir. Die Angst, in die Fänge der Geheimpolizei zu geraten, begleitete das junge Paar. „Ich hatte Angst. Um meine Frau, um mich. Wir konnten uns nie sicher sein, ob wir nicht doch verraten werden oder uns die Schlepper einfach irgendwo aussetzen. Vielleicht lebendig, vielleicht aber auch tot“, erinnert er sich.
Quälende Ungewissheit
Kurz vor der Grenze wurden Amir und seine Frau ausgesetzt. Irgendwo im Niemandsland, in der Nähe eines wenig kontrollierten Grenzweges. „Wir sind acht Stunden durch die Dunkelheit marschiert, jeder mit einem kleinen Rucksack mit Kleidung und Lebensmitteln. Ich wusste nicht, ob wir nach vorne, nach hinten oder nur im Kreis laufen. Es war schrecklich“, sagt Amir. Irgendwann erreichte das Paar die Türkei. Mit einem Kleintransporter wurden sie nach Kartal gebracht, einem Vorort von Istanbul. „Drei Wochen waren wir in einem kleinen Raum eingesperrt, und durften nicht raus.“ Dann waren die Ausreisepapiere fertig und die zuständigen Beamten der Flughafenkontrolle bestochen. Amir und seine Frau reisten als türkische Staatsbürger in Deutschland ein. Ein „Herzlich willkommen in Düsseldorf“-Schild, empfing die beiden.
Gute Standards?
Wenn man bedenkt, dass Deutschland vergleichsweise gute Standards für den Umgang mit Flüchtlingen hat, so will Amir sich gar nicht erst vorstellen, wie es andernorts abgelaufen wäre. Immer wieder erbittet er sich Bedenkzeit, wägt seine Worte gut ab. In einem Moment möchte er etwas sagen, bricht dann aber mitten im Satz ab. In einem anderen Moment will er aufschreiben, was er erlebt hat, kommt dann aber nicht über einige wenige Worte hinaus. „Wir wurden mit 150 anderen Flüchtlingen in ein Übergangsheim gesteckt. 150 Menschen und nur eine Toilette mit Dusche. Die Duschkabine hatte nicht einmal eine Tür“, erinnert sich Amir. „Und für die medizinische Versorgung war ein einziger Arzt zuständig, der gegen alle Beschwerden nur Aspirin verschrieben hat. Das Schlimmste aber war die Ungewissheit. Wir wussten nicht, ob wir als Flüchtlinge anerkannt oder ob wir zurückgeschickt werden.“
Asylrecht
Das zuständige Amt prüfte den Asylantrag des Paares. In der Zwischenzeit wurde ihnen ein kleines Zimmer mit zehn Quadratmetern zugewiesen. Eine bittere Lebensrealität für mehrere Monate, eingeschränkt auf einen Radius von 15 Kilometern rund um ihren Wohnblock in Solingen. „Wir waren isoliert von den Menschen. Dabei hatte ich doch Familie in Wuppertal“, erinnert sich Amir. Er hielt sich nicht an die Bestimmungen, zu groß war die Sehnsucht, seine Eltern in Ronsdorf zu besuchen. Die Strafe für den Verstoß gegen die sogenannte Residenzpflicht war empfindlich: „Von den monatlich 200 Euro Lebensunterhalt musste ich 100 Euro Strafe zahlen.“ Zudem drohte ihm die Abschiebung. Trotz der nachweislichen Verfolgung Amirs, lehnte das Oberlandesgericht seinen Asylantrag ab. Erst mit Unterstützung des Caritasverbandes konnte Amir die drohende Ausweisung aufschieben: „Ich habe hier das erste Mal Hilfe bekommen und auch ein wenig Vertrauen in die Menschen zurückgewonnen.“ Zudem bürgte seine hier als Flüchtlinge anerkannte Familie für ihn. Eine finanzielle Unterstützung von den Behörden war damit ausgeschlossen. „Aber die wollte ich auch gar nicht“, sagt Amir. „Ich wollte arbeiten.“
Integration?
Im elterlichen Geschäft konnte er dann eigenes Geld verdienen. Für sich und seine Frau. Wie schnell sich jemand einlebt, hängt vom Einzelnen ab. Und Amir wollte sich schnell einleben. Dafür hat er einen großen Teil seines geringen Lohns für Sprachkurse investiert: „An offiziellen Sprachkursen durfte ich ja nicht teilnehmen. Ich war vorerst nur geduldet. Somit habe ich auch keine Unterstützung für Deutschkurse bekommen.“ Nach Jahren der Ungewissheit, nach ständigen Auseinandersetzungen mit den Behörden, kam dann endlich die erlösende Nachricht. Amir und seine Frau erhielten eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Unbegreiflich ist, dass diese ihrem in Deutschland geborenen Sohn bis heute verwehrt wird. Für das dreijährige Kind muss Amir bis heute alle sechs Monate die Aufenthaltserlaubnis verlängern. „Da kann man anscheinend nichts machen“, sagt Amir und zuckt mit den Schultern.
Heimat gefunden?
Heute ist Amir ein angesehener Geschäftsmann. Seinen Leidensweg sieht man ihm nicht an. Er spricht selten darüber. Wenn überhaupt, dann mit Freunden oder Leidensgenossen: „Ich kenne viele Flüchtlinge, die das selbe durchgemacht haben oder noch erleben. Aber offen über uns zu sprechen, ist zu gefährlich. Das kann das Leben unserer Verwandten im Iran gefährden.“ Mittlerweile beschäftig Amir fünf Mitarbeiter und einen Auszubildenden. „Ich habe hier meinen Ausbilderschein gemacht“, sagt Amir. Er ist Teil dieser Gesellschaft geworden, obwohl eben diese es ihm nicht immer leicht gemacht hat. Auf die Frage, ob er hier richtig angekommen ist, kommt ein klares „Ja!“. Ist Deutschland nun seine Heimat? Amir schüttelt leicht den Kopf: „Ich bin hier zu Hause. Heimat, das ist etwas anderes!“


 Impressum Datenschutz
Impressum Datenschutz